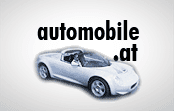Toyota Proace City Verso L2 (2024) im Test: Funktionalität vor!
Der Hochdachkombi bietet viel Raum auf kompakten Maßen, Komfort treibt jedoch unnötig den Preis

Toyotas neue Brennstoffzellen stärker auf Laster ausgerichtet

Toyota Proace City Verso L2 (2024) im Test: Funktionalität vor!

Toyota RAV4 GR Sport: Hybrid-SUV im Dauertest-Check

Toyotas neuer 2.0-Liter-Turbomotor hat sehr viel Leistung

Toyota Land Cruiser 250 (2025): 5 Sterne im ANCAP-Crashtest

Toyota Corona MK II (1975): Unterwegs im Japan-Fastback

Toyota Urban Cruiser: Äquivalent zum Suzuki eVitara vorgestellt

Im neuen Toyota Land Cruiser 250 (2024) durchs Atlas-Gebirge
Für den Personentransport angepasste Kastenwagen oder Hochdachkombis sind nicht totzukriegen. Sie vereinen in kompakten Abmessungen den Raum der Nutzfahrzeuge mit einigen Annehmlichkeiten von Pkws. Damit sind sie für große Familien genauso zu gebrauchen wie für den sportaffinen Lifestyler oder in der Mobilität eingeschränkte Personen.
Was ist das?
Der Toyota Proace City kam 2020 auf den Markt und hat 2024 sein erstes Facelift erhalten. Wie sein großer Bruder Proace, teilt er sich aus wirtschaftlichen Gründen seine Plattform mit Modellen des Stellantis-Konzerns. Ebenfalls auf der EMP2-Plattform basieren ganze vier Schwestermodelle: Citroën Berlingo, Fiat Doblo, Opel Combo und Peugeot Rifter.

Zudem gibt es den Proace City Verso in einer Kurz- (L1) und einer Langversion (L2) mit fünf oder sieben Sitzen als Benziner, Diesel (Schalter oder Automatik) und als vollelektrische Variante. In Toyotas Multipath-Strategie soll sich also für jeden Topf ein passender Proace-City-Deckel finden lassen.
Unseren Testwagen wurde von einem 1,5-Liter-Diesel mit 130 PS und 8-Stufen-Automatik angetrieben. Die Langversion als Siebensitzer kam in der Team-Deutschland-Variante, die als Sondermodell mit Preisvorteilen zu den Olympischen Spielen 2024 eingeführt wurde, jetzt aber nicht mehr erhältlich ist. Vergleichbar wäre diese am ehesten mit der Lounge-Ausstattung.
Springen Sie direkt zu:
Exterieur | Interieur | Fahrbericht | Preise und Konkurrenz | Fazit
Exterieur
Es herrscht Einheitslook. Angepasst gegenüber seinen Schwestermodellen wurden lediglich Frontscheinwerfer, Grill, Frontschürze, Heckleuchten und Logos. Die Seitenansicht ist bei allen Fabrikaten identisch. Schaut man ihnen in die Augen, ist jedoch immer die Zugehörigkeit zur Marken-Familie erkennbar.
Die Langversion des Proace City Verso bietet auf 4,75 Meter Länge beidseitig Schiebetüren für einfachen Zugang, um beispielsweise Kinder in engen Parklücken besser versorgen zu können. Im Test brauchte es ein wenig mehr Kraftaufwand, um diese auch wieder schließen zu können. Dafür kommt die fahrerseitige Schiebetür mit einer Blockade, falls der Tankdeckel mal geöffnet ist. Sie vermeidet demnach große Desaster durch internalisierte Trotteligkeit.



Das Heck bietet eine Klappe, bei der sich kleinere Menschen auf einer Höhe von 1,84 Meter schon ordentlich strecken müssen, um diese wieder schließen zu können. Hier wären Flügeltüren angebrachter. Leider gibt es die laut Konfigurator nur in der Kurzversion. Ansonsten herrscht genau das Gegenteil von "Style over Substance". Der Toyota Proace City Verso richtet sich nach der Funktionalität.
Interieur
Das gilt ebenfalls für den Innenraum. Hier dominiert Hartplastik das Bild und unterstreicht damit die Herkunft aus dem Nutzfahrzeugsektor. Ebenfalls typisch: viele, zum Teil verschließbare Ablagefächer, die gerne auch mal eine Einrastfunktion aufweisen könnten. Die Becherhalter sind recht schmal ausgefallen. Meine Standard-500-ml-Thermosflasche passte dort nicht rein und hätte aufgrund der Platzierung oben auf dem Armaturenbrett und geringer Tiefe ebenfalls für Sichtprobleme gesorgt. Hier passt wohl maximal nen schlanker Kaffee oder eine 330 Milliliter Energie-Dose.
Ein zehn Zoll großes Infotainment-System sorgt für zentralen Überblick und Einstellungsmöglichkeiten. Das funktioniert soweit ohne große Denkpausen und große Verschachtelung, könnte aber auch einen Tick zugänglicher sein (Android Auto ist ebenfalls mit an Bord). Für die wichtigsten Fahrerinfos hat der Proace City Verso ein weiteres Kombiinstrument im Fahrersichtfeld. Jedoch fielen beide Bildschirme auf einer Fahrt für etwa 15 bis 20 Sekunden aus. Die Displays blieben schwarz. Das System musste sich komplett neu starten ... das Fahrzeug blieb jedoch fahrbar.
Zudem hatten die Sensoren immer wieder zu kämpfen: Die 360-Grad-Parkkamera erfasste im Test nur ein Drittel der Umgebung. Einige Fahrassistenten fielen auf einer Fahrt bei einer Temperatur von unter null Grad komplett aus und der Anschnallsensor brauchte manches Mal etwas Zeit, um zu registrieren, dass alle Personen bereits angeschnallt waren. Etwas unglücklich angebracht ist zudem die Schalterleiste links neben dem Lenkrad, die durch dieses in jedem erdenklichen Blickwinkel verdeckt wird.
Aber wer sich für einen Hochdachkombi interessiert, kauft ihn vor allem wegen des angebotenen Raumes und seiner Nutzwerte. Zwar ist das Kofferraumvolumen mit allen Sitzen in Gebrauch eher überschaubar, aber wenn nur die dritte Reihe umgeklappt wird, steigt dieses auf 806 Liter - wohlgemerkt mit eingebauten Sitzen.
Die zwei letzten Einzelsitze lassen sich jedoch im Handumdrehen ausbauen und im Haus oder der Garage verstauen. Bei weiterer umgelegter zweiter Reihe steigt das nutzbare Volumen auf bis zu stolze 2.693 Liter. Zur Visualisierung: Der fast fünf Meter lange VW Bulli Nachfahre ID. Buzz kommt in der Langversion beispielsweise "nur" auf 2.469 Liter.



Fahrbericht
Langer Radstand, hoher Schwerpunkt und ein nutzfahrzeugtypisches Fahrwerk: im Proace City Verso sollte es gemächlich vorangehen. Das Fahrwerk ist nicht übermäßig weich, aber komfortabel, neigt sich in zügig angegangenen Kurven jedoch schnell zur Seite. Die Lenkung bleibt für städtische Quirligkeit zwar wendig aber in ihrem Feedback recht beliebig unbeeindruckt.
Der 1,5-Liter Diesel bietet 300 Nm Drehmoment und 130 PS. Das reicht aus, um eine ganze Großfamilie mit Gepäck ins Rollen zu kriegen. Dynamisch muss das in dieser Fahrzeugklasse nicht sein - vielmehr zweckmäßig. Zum Anfahren und in Schwung kommen reicht die Kraft allemal, auch wenn der Diesel sich schnell angestrengt anhört. Schuld daran ist aber eher die Isolation des gesamten Fahrzeugs und die gemächlich agierende 8-Stufenautomatik, die sich auch bei zügigem Beschleunigen so schnell nicht aus der Ruhe bringen lässt.


Alles im erwartbaren Bereich also. Damit bietet der Proace Kastenwagen absolut ausreichende Fahrwerte, wenn auch mancher Hochdachkombi etwas Pkw-ähnlicher unterwegs ist. Wer es etwas dynamischer mag, sollte sein Augenmerk eher in Richtung VW Caddy richten.
Als kombinierten Verbrauch gibt Toyota laut WLTP 5,8 Liter an. Im Durchschnitt lag dieser im Test bei genau sechs Litern. Auf einer etwa 300 Kilometer gemächlich gefahrenen Autobahntour zwischen 120 und 130 km/h waren jedoch auch 4,5 Liter drin. Das ist für einen Klotz im Wind ein sehr guter Wert.
Preise und Konkurrenz
Die kurze Version (L1) des Toyota Proace City Verso startet mit Benziner bereits bei 24.835 Euro. Den langen Radstand (L2) inklusive massig Raum gibt es ab 27.690 Euro. Der Diesel im L1 ist ab 27.890 Euro zu haben, im L2 kostet er mindestens 31.670 Euro. Vollelektrisch gefahren wird im Proace City ab 38.830 Euro (L1), beziehungsweise 40.250 Euro (L2). Unser 7-Sitzer-Diesel-Testwagen als Team-D-Sondermodell kostete stattliche 40.990 Euro - unnötig!
Konkurrenz bilden klassischerweise VW Caddy, Renault (Grand) Kangoo und Ford Tourneo Connect. Auch den Dacia Jogger könnte man als günstige Alternative ins Feld werfen, wenn auch eher Lifestyle-Kombi statt nutzfahrzeugbasierter Van/Hochdachkombi. Weitere Mitspieler sind natürlich die Plattformbrüder Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Fiat Doblo und Opel Combo: Suchen Sie sich einfach ihr Lieblingsgesicht heraus.
Fazit: 7/10
Der Toyota Proace City Verso kommt über den Preis, den Raum und seinen Nutzwert. Alles andere ist dem unterzuordnen. Angebotene Fahrwerte und Komfort der Einstiegsvarianten reichen absolut aus. Der Umfang unseres Testwagen ist in dieser Klasse unnötig und treibt bloß den Preis. Ob es unbedingt die lange Version und ein Diesel sein muss, hängt vom individuellen Nutzen ab.
Der Diesel liegt zwischen 3.000 und 4.000 Euro über dem Benziner, ist auf der Langstrecke jedoch sparsam unterwegs - einfach mal durchrechnen. Unser Tipp: auf Komfort-Schnick-Schnack verzichten, Nutzfahrzeugcharme leben, in der Anschaffung sparen, und das übrige Geld für einen Urlaub mit ihm investieren. Vorausgesetzt die Software- und Sensorikprobleme werden gelöst. Dann könnte der Proace City Verso eventuell sogar eine 8/10 sein.